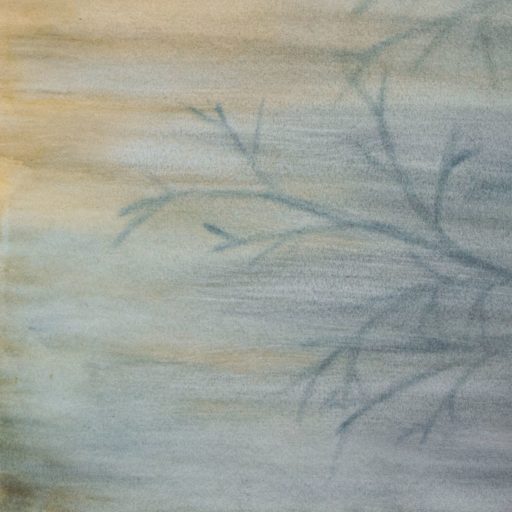Pechschwarzer Himmel. Rasende Wolken. Lichter, die grell vom Himmel zucken. Donner, so laut wie Paukenschläge direkt neben meinem Ohr. In einem Wort: Sturm. Wellen schlagen Bug hoch. Nein, höher. Brechen über mir zusammen. Der Wind zerrt an meiner Jacke. Will sie mir auszeihen. Versucht mit seinen kalten Händen unter den Saum zu greifen. Sie hoch zu ziehen. Meine nackte Haut zu berühren. Ich schlinge die Arme um mich. Halte die Jacke an Ort und Stelle. Halte mich warm. Oder sowas in der Art. Nur: Mit den Händen um den Oberleib geschlungen stehe ich nicht sicher. Fühle mich wie eine Spielfigur des Sturms, die von ihm hin und her geworfen wird. Ganz wie es ihm beliebt. „Also gut“, denke ich, „Wärme oder Halt?“ – ich entscheide mich für den Halt. Klammere mich verzweifelt an einem Mast fest. Das Gefühl weicht sekündlich aus meinen Fingern, sie können den Griff nicht mehr lange halten. Ich höre es quietschen. Was ist das? Ich blicke mich um. Blicke an mir herunter. Es sind meine Füße. Keine Ahnung wo genau die sind, spüren kann ich sie auf jeden Fall nicht mehr. Doch meine wassergetränkten Schuhe quietschen unter mir. Bei jeder Welle, jeder Böe, jeder Bewegung, die mich aus dem Gleichgewicht und ins Schwanken bringt, werde ich an meinen unsicheren Stand und den rutschigen Untergrund erinnert. Meine steifen Ohren pfeifen von dem unbändigen Wind, der mit lautem Getose in meine Ohrmuscheln fährt. In meinem Kopf dreht sich alles. Als säße ich auf einem Kettenkarussell. So eines, das sich nicht nur im Kreis, sondern sich gleichzeitig hoch und runter bewegt. Als sei Kreisen noch nicht ausreichend. So eines, auf dem einem auf JEDEN FALL schlecht wird – egal was man tut. Mein Herz rast in meiner Brust. Adrenalin schießt durch meinen Körper. Mein Bauch rumort und mir ist speiübel. Ich will hier weg, doch weiß nicht wie. Finde keine Lösung. Zu sehr bin ich abgelenkt von dem Unwetter um mich herum. Zu sehr fokussiert darauf, nicht den Halt zu verlieren. Zu sehr mit dem Schwindel und Chaos in meinem Kopf beschäftigt. Ich müsste einfach mal tief durchatmen, denke ich. Den Sturm Sturm sein lassen. Den Wind Wind sein lassen. Die Wellen Wellen sein lassen. Loslassen. Denn: Sie sind und bleiben da. Ob ich nun atme oder nicht. Ob ich nun an sie denke oder nicht. Ich weiß, sie tun mir nichts. Sie irritieren mich, bringen mich durcheinander, sorgen dafür, dass ich das Gefühl habe, nicht klar denken zu können. Eigentlich gar nicht denken zu können. Aber sie tun mir nichts. Außer mir die Kraft zu nehmen. Energie zu saugen. Mich zu verunsichern. Doch sie tun mir nichts. Auf jeden Fall nicht, solange ich die Ruhe bewahre und nicht in Panik ausbreche. Solange ich die Ruhe bewahre und nicht aufgebe. Also atme ich tief ein und aus. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das alles nichts bringt. Wer weiß das schon. Atmen. Und atmen. Das ist das Einzige, was ich mitten in diesem Sturm machen kann. Atmen und darauf warten, dass mein Puls sich beruhigt. Und dann, wenn mein Herz nicht mehr im Akkord pocht, wenn die Wellen ein wenig seichter werden, der Wind ein wenig milder weht, dann endlich kann ich erneut nachdenken. Und Handeln. Etwas anderes tun, als mich mit letzter Kraft festzuhalten. Loslassen und mich bewegen. Loslassen und mich umsehen. Loslassen und die Gegend erkunden. Loslassen und loslaufen. Loslassen, um vorwärts zu kommen.
Ich atme tief durch. Öffne meine Augen. Sehe mich um. Überall hängen Bilder. Ich sitze eingehüllt in eine Decke auf dem grauen, weichen Sofa. Meine Hände, meine Arme um mich geschlungen. Ich realisiere, dass ich nicht im Sturm stehe, sondern zu Hause bin. Um mich herum herrscht Ruhe. So viel Ruhe, wie in einer Stadt eben herrschen kann. „Herrschen“, denk ich. Das klingt übergriffig. Aber so sagt man es doch, „die Ruhe herrscht“, oder? Es ist auch egal. Denn es fühlt sich nicht an wie Ruhe. Sondern wie Sturm. Ich weiß, es ist keine Einbildung – der Sturm existiert. Er existiert in mir drin. Wild. Unbarmherzig. Laut. Brausend. Als rausche der Wind durch meine Glieder. Durch meine Adern, durch meinen gesamten Körper. Ich kann ihn hören. Kann ihn spüren. Als sei in meinem Kopf ein Tornado eingeschlossen, der sich so schnell dreht, dass ich keine Chance habe, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Er wirbelt alles durcheinander. Lässt mich wortlos zurück. Lässt mich verwirrt zurück. Lässt mich frustriert zurück. Ich bin klitschnass, doch nicht von den Wellen des Meeres, sondern vom Schweiß. Wellen der Angst. Wellen der Überforderung. Wellen der Anspannung. Wellen, die nicht über meinem Körper zusammenschlagen, sondern in ihm drin. Immer und immer wieder. Ich kann spüren, wie sie sich langsam aufbäumen, bevor sie mit einem lauten Krachen brechen, nur um von Neuen abgelöst zu werden. Meine Hände sind klamm vor Kälte – nicht der äußerlichen, denn hier ist es warm. Sondern der Kälte in mir drin. Meine Füße – ich spüre sie kaum, trotz der dicken Decke und der Wärmflasche, die ich über sie gelegt habe. Ich spüre die Wärme kaum, denn in mir drin ist alles kalt. Erstarrt. Gelähmt. Eingefroren. Ich versuche mich irgendwo festzuhalten, doch weiß nicht wo. Ich versuche loszulassen und loszulaufen, doch kann nicht sehen, wohin. Ich taumele im Sturm. Werde hin und her geworfen von meinen Gedanken, meinen Emotionen, meinen Gefühlen. Mal scheine ich oben auf der Welle zu stehen, dann falle ich scheinbar haltlos hinab ins Tal, in die Tiefe. Scheine keine Kontrolle darüber zu haben, was mit mir passiert. Scheine keine Kontrolle über das Unwetter in mir zu haben. Scheine einfach keinen festen Boden unter den Füßen zu bekommen. So sehr ich mich bemühe. Mir wasserdichte Klamotten anziehe, um dem Sturm zu trotzen. Mich festbinde, um nicht wegzuwehen. Mich umsehe, um Land zu entdecken oder irgendetwas halbwegs Stabiles, zu dem ich mich hinbewegen kann. Doch da ist nichts. Nur Chaos. Überforderung. Verzweiflung. Frust. Hoffnungslosigkeit. Die Sonne? Ich kann sie nicht wirklich sehen. Vielleicht dringt ab und an ein hauchdünner, doch noch nicht wärmender Strahl durch die dicke Wolkendecke hindurch. Für eine Sekunde, vielleicht ein paar Minuten, wird es hell. Erscheint alles ein wenig freundlicher. Weniger beängstigend. Für einen Moment denke ich: Ja, ich kann es schaffen. Es kann funktionieren. Einfach weitermachen. Dann wird es heller. Doch das wird es nicht. Stattdessen zieht die schwarze Wolkendecke wieder zu. Schottet mich ab vom Licht. Von der potentiellen Wärme der Sonne. Von der Hoffnung. Der Hoffnung auf ein erträgliches Leben.
Anmerkungen:
Text: Mai 2022.
Foto: Sommer 2020©Kristine.