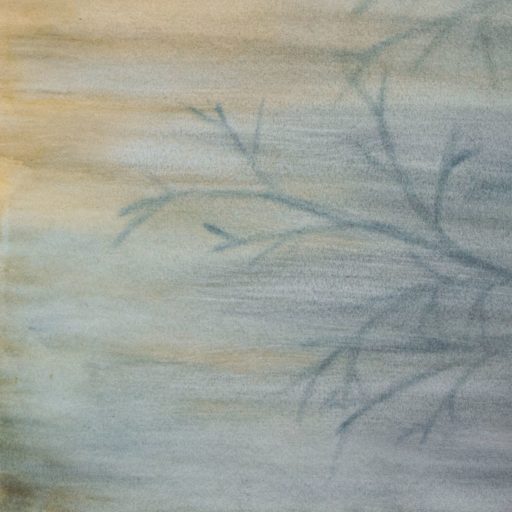Montag, die Woche geht wieder los. Wobei, wenn wir ehrlich sind, unterscheiden sich die Tage bei mir nicht wirklich. Nur, dass ich Sonntag nicht einkaufen gehen kann, weil die Läden geschlossen haben. Aber sonst? Oft weiß ich nicht mal, welcher Tag der Woche ist. Es ist auch irgendwie egal. Ich meine, wofür spielt es eine Rolle? Allerdings kommt es so auch mal vor, dass ich mittags irgendwann meine Sis anrufe, nur um festzustellen, dass sie arbeiten ist, weil noch gar kein Wochenende ist. Aber solange das das Hauptproblem ist, ist es ja in Ordnung, denke ich mir.
So, viel geredet ohne Inhalt; was ich eigentlich sagen wollte: Montag, Beginn einer neuen Woche und ich dachte ich nutze diese Gelegenheit mal, um einen Überblick über eine “normale” Woche bei mir zu geben. Warum? Weil ich glaube, dass es oft nicht vorstellbar ist, wie anstrengend jeder einzelne Tag sein kann. Wie schwierig es ist, immer wieder erneut zu kämpfen. Jeden Tag. Oft einfach nur zu überleben und nicht zu leben. Irgendwie zurecht zu kommen und sich nicht unter kriegen zu lassen. Mit den Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Mit den Gedankenkreisen, die gerne mal kommen. Es geht nicht darum zu jammern oder Mitleid zu kreieren. Auch nicht darum, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Deswegen: Höre hier auf zu lesen, wenn du das Gefühl hast!
Ich möchte einfach nur einen weiteren Einblick bieten. Einen Einblick, in das Leben mit einer psychsichen Erkrankung. Naja, eher mehreren, denn eine ist es ja nicht. Wer weiß, wie es mit einer aussehen würde – Gedanken, die nicht hilfreich sind und nichts bringen. Denn “et es wie et es”. Die folgende Woche ist nur ein Beispiel. Mal ist es deutlich extremer, mal deutlich entspannter. Jeder Tag ist eine Wundtüte.
„Du musst einfach mal Yoga machen!“ – „Ich muss gar nichts!“
MONTAG:
Wochenbeginn. Ich wache auf, sofort fängt mein Herz an zu rasen. Adrenalin schießt durch meinen Körper. Gleichzeitig fühle ich mich unfassbar müde. Wie spät ist es? Ich denke kurz nach, bevor ich auf die Uhr gucke. Ich weiß, ich war ca. alle 1 – 2 Stunden wach, hoffe aber, es ist schon 5, nicht erst 3. Ein Blick auf die Uhr reicht: kurz nach 3, zu früh zum Aufstehen. Also versuche ich noch einmal einzuschlafen. Um halb 5 gebe ich auf. Mache mir Tee. Viel Tee. Mehrere Tassen auf einmal, dann muss ich nicht so oft aufstehen. Und natürlich ein Kirschkernkissen – für die Gemütlichkeit. Lenke mich im Internet ab. Instagram, Youtube, was auch immer ich finde. Ich bemühe mich, mich nicht auf das Herzrasen zu konzentriere. Mich nicht davon verunsichern zu lassen. Denn sonst wird es schlimmer. „Du musst frühstücken!“, dröhnt es in meinem Kopf. Ja, ich weiß. Danke. Ich versuche es. Ich rede mir selbst gut zu, versuche mich zu überreden zu frühstücken. Gegen 9 Uhr schaffe ich es dann. Check! Was nun? Mein Kopf wird nebelig, mir wird schwindelig, meine Extremitäten fangen an zu kribbeln. Mist, die Panik kommt. Atmen!! Ablenken! Also Musik an und malen. Das beruhigt. Oder auch nicht – ich muss raus. Eine Runde spazieren gehen? Nee, lieber joggen. Los geht’s! Dann kalt-heiß-kalt-heiß Duschen. Die Angst nimmt ein wenig ab. Ich höre Musik und male. Bis sie wieder stärker wird. Ich drehe durch!! WAS SOLL DAS?!?! Ich muss raus, kann nicht mehr. Ab in den Laden, vielleicht kann ich irgend etwas sortieren. Egal was. Hauptsache Ablenkung. Ich platze in den Laden: KANN ICH WAS TUN?! ICH MUSS MICHABLENKEN!!!! Zum Glück kennen die mich dort schon, habe ich letzte Woche auch schon gemacht. “Na, wieder was sortieren?” Jup, danke. Mittag? „DU MUSST ESSEN“ Ja, ich weiß, aber ich habe keine Lust. Keinen Appetit. Keinen Bock. Egal. Also wieder Rosinenbrot mit Margarine und Schokocreme. Wie die letzten Tage schon. Wie eigentlich den ganzen Tag. Aber egal. Hauptsache essen. Ich liege auf dem Boden und starre die Decke an. Was soll ich nur machen?! Ammoniakampulle habe ich schon genommen, hat nichts gebracht. Naja, kurz vielleicht. Jetzt liege ich hier und versuche, meinen Drang nach Selbstverletzung nicht nachzukommen. Denn das wäre nicht gut. Das habe ich mir gemerkt. Wobei ich nicht mehr weiß, was daran eigentlich so schlimm sein soll. Schadet doch keinem!? Aber irgendwas in mir drin sagt: Gib nicht nach. Mir kommt ein Gedanke: Wein! Wein ist noch im Keller! Alkohol beruhigt dich! Soll ich mir da vielleicht was holen? NEIN! Du hast ihn doch gerade deswegen aus der Wohnung geräumt!! Es hat einen Grund, weshalb er im Keller weggeschlossen ist. Also liege ich weiter hier und bewege mich nicht. Ein Freund, ich nenne ihn Nathan, ruft an. Ich muss lachen über den Kram den er erzählt. Was für ein Blödsinn. Kann wieder ein wenig atmen. Mich bewegen. Es wird leichter. Abendbrot geht, ich esse während er am Telefon ist. Dann gehe ich schlafen. Es ist kurz nach 20 Uhr. Zu früh? Nein, alles ab 20 Uhr ist in Ordnung. Zumal ich ohnehin nicht direkt einschlafe, sondern noch eine ganze Weile herum liegen werde in der Dunkelheit. Um irgendwann wegzudösen und alle 2 Stunden wieder aufzuwachen.
„Du machst alles falsch.“ – „Ich darf Fehler machen.“
DIENSTAG:
Ich schrecke hoch: Wo bin ich?! Schweißgebadet wache ich auf. Orientierungslos. Schwitze. Friere. Langsam komme ich zu mir. Ich atme tief durch: „Ich heiße Kristine, bin 34 Jahre alt. Ich bin in Köln. In meiner Wohnung, in meinem Bett. Ich bist sicher.“ Langsam komme ich zu mir. Warum bin ich so verschwitzt? Die Erinnerungen schießen zurück in meinen Kopf. Albträume. Mehrere. Mal wieder… Sie hängen mir nach. Nicht nur die Bilder, sondern vor allem die Gefühle. Ich fühle mich niedergeschlagen, ängstlich, bedrückt. Will weg. Will, dass der Tag zu Ende ist. Ich habe keine Kraft mehr. Und gleichzeitig das Gefühl, als würde mein Körper vor Adrenalin beben. Ich will nicht mehr. Warum kann es nicht einfach vorbei sein?! Dann bekomme ich eine Nachricht von Nathan, muss lachen und es geht wieder. Ok, er hat Yoga gemacht, das schaffe ich auch. Trotz Kopfschmerzen. Scheiß drauf. Ich habe es mir doch gestern Abend ohnehin vorgenommen. Los geht’s. Und siehe da – es geht mir danach besser. Adrenalin strömt immer noch durch meinen Körper. ENERGIIIIIIEEEEE! Aufstehen und malen, malen, malen. Es sieht gut aus. Ich fühle mich gut. Ich kann das schaffen. Ich bin schön, klug, stark, frei, unabhängig, intelligent, wichtig, liebenswert!! Alles, was ich mir jeden Morgen im Spiegel erzähle. Wie konnte ich daran jemals zweifeln? Bald arbeite ich wieder und lebe ein normales Leben. Ich werde Menschen treffen, Sachen unternehmen. Die Krankheit ist besiegt! Therapie heute? Wofür eigentlich? Mir geht es doch gut! ——— CUT ———- Heulend laufe ich durch die Straße: Ich kann nicht mehr! Ich fühle mich einsam. Alleine. Meine Brust schmerzt. Ich will weg. LASST MICH ALLE IN RUHE!! Meine Sis ruft an, ich kann nicht ran gehen. Weiß nicht, was ich sagen soll. Schäme mich. Würde gerne was erzählen, aber das ist mir zu unangenehm. Keiner weiß davon. Naja, fast keiner. Nathan schon. Das ist irgendwie was anderes. Laufe weiter. In meiner Hand meinen Stressball. Nathan ruft an, ich gehe ran. Heule. „Hast du schon Ammoniak genommen?“ Oh, gute Idee. Danke. Jetzt wird es leicht besser. Reden hilft. Ab nach Hause. Zum Glück ist es gleich dunkel und Abend. Dann kann ich schlafen.
„Du bist viel zu hektisch und laut!“ – „Ich bin gut so wie ich bin!“
MITTWOCH:
Ich wache auf. Fühle mich gut. Heute ist mein Tag! Ab geht’s! Yoga, malen und vormittags im Laden gucken, ob alles passt. Nachmittags kommt noch eine Lieferung. Sieht aber alles gut aus. Einkaufen, Insta-Beitrag schreiben. Ein wenig lesen und dann wieder eine Runde malen. Ich strotze vor Energie. Kann kaum zwei Minuten ruhig sitzen ohne etwas zu tun. Wohin mit meiner Energie?! Uh, ich könnte doch eine neue Sprache lerne – erst einmal einen Babbel-Zugang kaufen. YEEEES, das wird gut! Ich gehe spazieren und helfe nachmittags beim Kistentragen im Laden. Auf dem Weg nach Hause kommen plötzlich die Tränen. Ich kann nicht mehr. Alle Kraft ist weg. Was soll nur aus mir werden? Mein Körper ist aus Blei. Gleichzeitig taub. Wie soll ich jemals wieder eine Arbeit finden? Überhaupt fähig sein zu arbeiten? Es wird einfach nicht besser. Es ist so schwer. So ungerecht. Und ja, ich weiß, auch wenn es ungerecht ist, die Verantwortung liegt bei mir. Ich kann es nicht mehr hören: Eigenverantwortung. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, dauernd zu kämpfen?! Bin kurz vorm Ausflippen. Schreie Plakate an, die auf der Straße hängen. Was soll der scheiß?! Alle gucken so fröhlich – was für eine Farce! Lasst mich bloß in Ruhe. Zu Hause bemühe ich mich, etwas zu essen. Rosinenbrot geht. Geht immer. Und Eis. Also gibt es Eis, Rosinenbrot und Schokoaufstrich zum Abendbrot. Besser als nichts. „Du solltest endlich mal gesünder essen!“, mahnt mich eine Stimme im Kopf. Ach halt den Mund! Immerhin esse ich überhaupt! Endlich ins Bett. Gedanken kreisen. Ich versuche zu atmen. Mich darauf zu konzentrieren. Irgendwann wird es leichter. Ich schlafe ein.
„Du musst dich nur mehr anstrengen!“ – „Ich gebe stets das, was gerade möglich ist.“
DONNERSTAG:
Mein Körper ist aus Blei. Schwer. Kann mich kaum bewegen. Blick auf die Uhr: 5 Uhr. Ok, das reicht, keine Lust mehr, ich stehe auf. Also zumindest in Gedanken. Denn mein Körper gehorcht mir nicht. Liegt einfach da. Ist schwer. Licht an. Atmen. Mich selbst motivieren, dass ich es schon kann. Hilft aber alles nichts. Ok, dann zähle ich bis 10 und stehe auf. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ….10!! Aufstehen!!! Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Denn heute steht nichts an bis halb 1. Wen interessiert es schon, ob ich aufstehe?! Jaja, Selbstfürsorge. Eigenverantwortung – my ass! RUHE IM KOPF! Es interessiert mich nicht. Steck du mal in meinem Köper! Ach ja, tust du ja. Na gut, dann akzeptiere es doch wenigstens, dass es gerade nicht geht. Zwei Stunden, einige Nachrichten und viel Überzeugungskraft später sitze ich immerhin schon mal mit Tee im Bett. Sitzen ist ein guter Fortschritt. Das wird noch. Irgendwas läuft auf Netflix. Ich gucke nicht hin. Es ist mir auch egal. Will nur meine Gedanken einfach nicht hören. Also übertöne ich sie. Ok, komm, wir schaffen es zu frühstücken, denk ich. Wer ist „wir“ fragst du dich? Na, das bin ich und meine Anteile. Denn irgendwie fühlt es sich an, als bestünde ich nicht nur aus einer, sondern mehreren Personen. Also „wir“ – immerhin müssen alle an einem Strang ziehen, sonst wird es nichts. Zwei Stunden später habe ich auch dieses Problem gelöst. Vollkommen fertig lege ich mich wieder ins Bett. Erst einmal eine Runde schlafen. Wäsche? Haushalt? Emails beantworten? Verschoben. Ja ich weiß, spazieren gehen wäre eine gute Idee. Malen vielleicht auch. Aber erst einmal liegen. Dann malen. Oder auch nicht. Malen geht nicht. Aggressionen drängen durch, ich habe das Bedürfnis, das Bild zu zerstören. Oder komplett schwarz zu malen. Also aufhören. Was nun?! Zu früh zum Telefonieren, Nathan ist noch auf der Arbeit. Außerdem muss ich doch auch mal selbst klarkommen. Ich kann doch nicht immer auf ihn angewiesen sein?! Na gut. Spaziergang und dann in die Bar, Gemüse kommt gleich. Immerhin Ablenkung. Aber dann ist es auch erst halb 2. Der ganze Tag ist noch vor mir! Was nun? Plötzlich ist es 18 Uhr. Was ist passiert?! Keine Ahnung. Irgendwie ging der Tag vorbei. Was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir auch egal. Ich kann gleich schlafen.
„Du bist faul!“ – „Ich habe das Recht mich auszuruhen.“
FREITAG:
Es ist 10 Uhr, ich weiß nicht wo ich bin. Bin vollkommen durch den Wind. Ach ja, jetzt fällt es mir ein: Ich habe gestern Abend meine Antipsychotika genommen. Kann diesen schlechten Schlaf, bei dem ich jede Stunde, manchmal auch nur alle zwei, aufwache, nicht mehr ertragen. Aber ist das besser?! Mein Kopf ist benebelt, ich fühle mich unwohl, schwindelig. Taub. Ja, taub irgendwie auch. Gleichgültig. Alles ist egal. Also bleib ich liegen. „Bist du bescheuert?! Es ist schon 10 Uhr! Du liegst eh schon viel zu lange hier herum! Sei nicht so faul und tu endlich was!!!“, schreit es in meinem Kopf. Ach halt die Klappe, denk ich, drehe mich um und schlafe wieder ein. Vollkommen verschwitzt wache ich wieder auf, 11 Uhr. Der Albtraum sitzt mir im Nacken. Mir ist immer noch schwindelig, mein Kopf vernebelt, aber ich stehe auf. Kann das unangenehme Gefühl des Albtraums nicht mehr ertragen. Duschen: Heiß, kalt, heiß, kalt… Ok, jetzt ist es besser. Frühstück und Tee und die Welt sieht ein wenig besser aus. Aber tun kann ich heute nichts, dafür ist mein Kopf zu matschig. Mein Herz fängt wieder an zu rasen, also gehe ich eine Runde spazieren. Danach liege ich auf meinem Bett. Starre an die Decke. Hoffentlich ist es bald Abend und ich kann endlich wieder schlafen. Wir telefonieren, ihm geht es heute auch schlecht. Egal, Hauptsache wir sind beide nicht alleine. Schweigen uns an, aber auch das ist ok. Mhm, was nun? Keine Ahnung. Sprache lernen?! Keine Ahnung, wie ich auf diese blöde Idee gekommen bin. Egal, fangen wir nächste Woche mit an.
„Mit dir hält es eh keiner aus!“ – „Ich bin liebenswert.“
SAMSTAG:
Draußen ist es – wie immer – noch dunkel. Ich sitze auf dem Bett und trinke Tee und koffeinfreien Kaffee. Koffeinfrei? Ja genau. Ich habe Sorge, dass Koffein zu mehr Herzrasen führt und das brauche ich nun wirklich nicht. Also lieber ohne Koffein. Ich gucke mir Sachen im Internet an, ohne sie genau zu sehen. Es ist mir auch egal. Überlege, ob ich mich noch mal hinlege, aber habe keine Lust. Also weiter machen, abwarten. Warten. Worauf? Ich weiß es nicht. Die Sonne kommt raus, es wird ein guter Tag. Also vom Wetter her. Wie es mir geht, weiß ich nicht. Ich spüre nichts. Leere und Gleichgültigkeit vielleicht. Auch ok. Was soll’s. Vielleicht sogar angenehmer als dieses auf und ab der Gefühle. Angenehmer als beißende und nagende Einsamkeit und Traurigkeit. Als Aggressionen, die sich in Anspannung äußern und raus wollen. Obwohl – Anspannung ist trotzdem da. Merkwürdig. Aber so ist es eben. Wenn ich meinen Kopf zu schnell bewege, fühlt es sich an, als würden Stromschläge durch meine Arme und Hände schießen. Unangenehm. Vielleicht einfach nicht so viel bewegen. Kopf in eine Richtung richten und gut ist. Gibt doch eh nichts, was ich angucken will. Nathan holt mich ab, wir gehen eine Runde spazieren. Gute Idee. Ab in den Wald. Dort ist es morgens noch recht leer und die Luft ist klar vom Regen in der letzten Nacht. Es riecht nach Herbst. Es ist nicht kalt, aber kühl. Die Sonne kommt teilweise raus – sie wärmt uns. Wir reden und gehen. Wir schweigen und gehen. Wir sitzen und reden. Sitzen und schweigen. Die Zeit vergeht. Es ist angenehm. Ich fühle mich wohl und geborgen. Kann so sein wie ich bin. Kann fluchen und meckern. Kann lachen und singen. Es ist egal. Alles ist in Ordnung. Wir sind wir. So wie wir sind. Zurück zu Hause kommt sofort das Einsamkeitsgefühl wieder. Ich weiß, dass es immer nach einem „Abschied“ da ist. Denn dann bin ich wieder alleine. Ich weiß, dass es mein verletzter innerer Anteil ist, der sich da meldet und dem nur ich helfen kann. Dem nur ich Sicherheit bieten kann, nicht irgendeine andere Person. Das alles weiß ich, aber wissen hilft nicht immer. Ich male, lese und telefoniere. Und der Tag geht vorbei. Wie jeder andere auch. Irgendwie.
„Du bist unwichtig” – „Ich bin wichtig.“
Sonntag:
Ich bin verabredet. Das kommt nicht oft vor, aber ich freue mich. Ein wenig nervös bin ich auch, aber das kenne ich schon. Angst, dass sie nicht kommt. Angst, nicht zu wissen, was ich erzählen soll. Angst vor unangenehmen Pausen. Obwohl wir uns schon öfters getroffen haben und ich mit ihr gut zurecht komme. Morgens male ich wieder, aber es läuft nicht so gut. Also versuche ich mich an Sport. Ein bisschen Sport ist besser als nichts, denke ich. „Entgegengesetztes handeln“ – und was soll ich sagen, es hilft. Die heiß-kalte Dusche natürlich auch. Und das Chatten. Ich gehe los, die Sonne scheint, die Blätter leuchten und ich denke: Es ist so schön. Warum fühle ich es nicht? Ich fühle mich leer. Alles fühlt sich sinnlos an. Wofür?! Dieses Wort schwebt in meinem Kopf umher. Mich hat keiner gefragt, ob ich auf dieser Welt sein will. Ich bekomme diese ganzen Erkrankungen und Kämpfe aufgedrückt, ohne, dass mich jemand fragt, ohne dass ich es will. Ohne, dass ich danach gefragt hätte. Und was bleibt mir übrig? Ich muss damit zurecht kommen. Oder eben nicht. Aber das ist noch anstrengender. Jedenfalls meistens. Ich werde sauer. Auf das Leben. Auf mich. Was soll der ganze Sch… hier?! Wie gerne würde ich aufgeben. Aber das geht nicht. Das Treffen ist schön. Wir reden und reden. Tauschen uns aus. Stellen Gemeinsamkeiten fest. Schwierigkeiten, die wir beide haben. Und Unterschiede. Aber es tut gut, frei reden zu können. Denn sie versteht mich. Ich verstehe sie. Das hilft. Ich muss mich nicht groß erklären. Auch das ist gut. Ich fühle mich stärker. Fühle mich gut. Ich schaffe das. Ich bin stark und kompetent. Ich bin gut so wie ich bin. Ich habe schon vieles geschafft. Ich bin motiviert. Alles läuft. Ich bin ganz weit oben. Strahle. Wieso kann es nicht immer so sein? Aber irgendwie fühlt es sich auch verkehrt an. Kann das sein? Ja klar, ich bin es nicht gewohnt. Trotzdem ist es auch gut. Ich genieße es. Zumindest für eine kurz Zeit. Bis ich wieder falle. Hallo Loch, schön, dass du wieder da bist. Ich kann nicht mehr! Zum Glück ist gleich Abend.
„Was dich nicht tötet härtet ab.“ – „Es darf mir auch mal schlecht gehen.“
Eine normale Woche. Der normale Wahnsinn. Der tägliche Kampf. Nicht ein Tag ohne Kämpfen. Kaum ein Tag, an dem ich wirklich lebe. An den meisten überlebe ich nur. Versuche irgendwie noch „etwas Positives“ zu machen, aber es fühlt sich alles verkehrt an. Als täte ich nur so als ob. Ich lebe nicht. Ich existiere nur so vor mich hin. Mache Sachen, weil man das so tut und weil ich sonst irre werde. Also mehr als ohnehin schon (Achtung: Selbstabwertung! Ja, ich merke es…). Kann mich selbst kaum ertragen, kann mir aber auch nicht entkommen. Auch wenn ich es versuche. Ich frage mich, wie andere Menschen es schaffen, jeden Tag erneut aufzustehen und weiter zu machen. Denn fast jeden Tag wünsche ich mir, dass es vorbei ist. Denn ich bin müde. Kann nicht mehr. Habe keine Lust mehr mich über die kleinen Erfolge zu freuen. Für die kleinen Momente zu leben, wenn ich doch weiß, das nächste Tief steht an. Das ist anstrengend! Ich habe das Gefühl, als befände ich mich in einem Film. Kaum etwas ist real um mich herum. Ich erkenne manchmal Menschen kaum wieder. Gegenden auch nicht. Und ich weiß kaum mehr, was ich an den vorangegangenen Tagen gemacht habe. Es ist, als würde jemand anderes mein Leben leben. Also das Leben, was offenbar meins ist. Denn mein Körper ist ja hier. Mein Geist auch manchmal. Oft aber auch nicht. Wo er ist? Keine Ahnung. Mal hier, mal da. Ich versuche mich mit diesem Leben abzufinden und anzufreunden. Ok, vielleicht eher es zu akzeptieren. Aber es fällt mir schwer. Denn mein Traum sah anders aus. Mein Traum, mein Lebensentwurf. Sie existieren nicht mehr. Können nie mehr Realität werden.
„Du bist halt eben ein bisschen komisch!“ – „Ich bin genug, genau so wie ich bin!“
Und während ich das auf der einen Seite bedauere und riesige Schwierigkeiten habe loszulassen und das Hier und Jetzt so anzunehmen, wie es ist, so bin ich auf der anderen Seite auch froh. Froh, denn es war nie für mich bestimmt. Ich bin anders. Anders als die meisten dachten. Anders, als ich es dachte. Anders, als ich sein sollte. Anders eben. Und das ist ok. Denn nicht jeder kann gleich sein. Das wäre langweilig. Nur muss ich jetzt herausfinden, was mein „anders“ für mich bedeutet. Wer ich jetzt gerade sein möchte. Und wie ich jede weitere Woche, jeden weiteren Tag, jede weitere Stunde, Minute, Sekunde gestalten kann und will.
Anmerkungen:
Text: November 2021.
Foto: Oktober 2012©Kristine.