Donnerstagnachmittag. Ich bin auf meinem täglichen Spaziergang. Meinem „ich-muss-einmal-am-Tag-raus-das-soll-gut-gegen-Depressionen-sein“-Spaziergang. Ich gehe am Wasser entlang. Ich glaube, dass es die Wakenitz ist, es kann aber auch ein anderer Fluss sein. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Es ist auch egal, ich muss ja nur gehen. Schritt für Schritt. Ich höre ein Hörbuch. Die drei Fragezeichen. Bitte was?! Ja, du hast richtig gelesen. Ein Kinderhörbuch. Aber es beruhigt mich. Es ist so schön einfach und oft kann ich darüber lachen. Plötzlich geht das Hörbuch aus und mein Puls fängt an zu rasen, denn: Wenn das Hörbuch ausgeht, klingelt meist kurz darauf das Handy. Und schon höre ich den Klingelton. Ich sehe die Nummer, erkenne sie als Nummer der Tagesklinik Merheim. Och nee, denke ich. Was wollen die denn jetzt? Ich überlege, ob ich abnehmen soll. Ich telefoniere nicht gern. Vor allem nicht, wenn ich nicht weiß, wer wirklich dran ist und weshalb. Ich habe doch gestern erst mit denen telefoniert? Immerhin muss ich dort jede Woche anrufen und mitteilen, dass ich noch auf der Warteliste stehen möchte. Was wollen die jetzt? Ich weiß es nicht. Das versetzt mich in Stress. Habe ich irgendetwas vergessen? Irgendetwas verkehrt gemacht? Eigentlich will ich nur in Ruhe gelassen werden.
Aber was soll’s: Irgendwie muss ich mich ja ab und an meinen Ängsten stellen. Also gehe ich mutig und ängstlich zugleich dran. Es ist tatsächlich die Tagesklinik in Merheim: „Guten Tag, es ist ein Aufnahmetermin frei. Sie können direkt am Montag kommen.“ Ich muss nachfragen: „Diesen Montag?“ Ja, ich habe mich nicht verhört. Diesen Montag soll es los gehen. In meinem Kopf rasen die Gedanken: Aber ich kann doch diesen Montag nicht? Ich wollte doch morgen mit meiner Schwester für eine Woche an die Nordsee fahren??! Das passt doch nicht und außerdem haben die mir doch etwas von drei bis vier Monaten Wartezeit erzählt – es sind aber erst knapp drei Monate?
Mein Herz schlägt schneller, ich schwitze. In meinem Kopf bahnt sich Nebel an – ich breche in Stress aus. Der Arzt am Telefon erzählt mir irgend etwas darüber, wann ich wo sein soll und was ich mitbringen muss. Ich habe Schwierigkeiten mich zu konzentrieren, zuzuhören, mir das alles zu merken. Denn mir ist plötzlich alles zu viel: Die ganze Geräusche um mich herum, der Wind und die pralle Sonne auf meiner Haut, die Stimme des Mannes im Telefon, meine Gedanken. Ich versuche mich zu konzentrieren, schweife ab. „Mir geht es doch endlich seit ein paar Tagen besser. Ich hatte so viele Ideen, was ich jetzt machen möchte, vor allem mehr malen. Und mehr im Ehrenamt arbeiten. Wieso muss ich jetzt in die Klinik?!“ „Kann ich das irgendwie verschieben?“, höre ich mich fragen. Doch im gleichen Moment weiß ich, dass das für mich keine Option ist. Die Angst wird dadurch nicht weniger. Ich muss da jetzt durch. Also sage ich zu und lege auf.
Der innere Druck ist angestiegen, die Anspannung ist hoch, ich fühle mich rastlos, obwohl ich in Bewegung bin. Was jetzt? Nein, das ist nicht die Frage, die sich mir immer und immer wieder aufdrängt, wird mir bewusst, sondern: WAS IST, WENN ICH DAS NICHT SCHAFFE? Es fühlt sich an wie eine letzte Chance. Ich bin so lange schon in Behandlung, ich möchte endlich einen deutlich spürbaren Erfolg sehen in den eingeschränkten Bereichen. Aber ich habe Angst, dass ich der Anforderung nicht gewachsen bin. Jeden Tag 8 Stunden mit über 10 Menschen zusammen?! Wie ich das aushalten soll, weiß ich nicht. Zusätzlich fast je eine Stunde Hin- und Rückfahrt mit dem Zug. Und dann die ganzen Therapien, strikte Programme, keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich steigere mich rein. Muss mich ablenken. Will telefonieren und erreiche meinen Bruder. Zum Glück. Er ist gerade draußen, hat sich eine Pause genommen – perfektes Timing. Ich erzähle ihm von meinen Gedanken, meinen Emotionen, von der Möglichkeit der Klinik und so langsam beruhige ich mich. Denn rational weiß ich, natürlich ist es etwas gutes. Ich wollte dahin. Naja, wollte ist relativ: Ich habe beschlossen, ich muss dahin wollen, wenn sich etwas tun soll.
Also: Ich wollte in diese Klinik, weil sie eine DBT Behandlung anbieten. Dialektisch-behaviorale-Therapie. Ein 12-Wochen-Programm, welches ursprünglich für chronisch suizidale Menschen entwickelt und für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung weiter entwickelt wurde. Sehr passend für mich also. Dennoch habe ich natürlich Angst, denn es wird sehr anstrengend werden. Viel Auseinandersetzung mit mir selbst. Mit Bereichen meines Ichs, zu denen ich nicht so gerne Kontakt habe. Fremde Menschen, fremde Strukturen, fremder Tagesablauf und fremdes Essen. 12 Wochen lang. Das versetzt mich in Anspannung. Gut, dass ich bereits einige Klinikerfahrungen habe. Das hilft. Dennoch wüsste ich gerne ein wenig mehr was mich erwartet.
Aber jetzt heißt es erst einmal: Pläne umstellen, neuen Zug buchen, alten Zug stornieren, mit meiner Schwester sprechen und ihr erzählen, dass sie alleine in den Urlaub muss, meinen Therapeuten informieren, Unterlagen von meiner Psychiaterin erbeten.
Doch zuerst mache ich jetzt Yoga. 30 Minuten langsames, geführtes Yoga, um ein wenig herunter zu kommen. Denn ich bin immer noch aufgeregt. Obwohl der Anruf jetzt schon circa zwei Stunden her ist. Nervös und gespannt. Freudig und ängstlich. Alle Emotionen sind vertreten. Das ist in Ordnung für mich. Die innere Anspannung ist zwar hoch, aber ich schaffe es, ohne Selbstverletzung mit den Emotionen zurecht zu kommen. Ich atme tief ein und aus und hoffe, das meine Schwester gleich nach Hause kommt – ein wenig reden hilft bestimmt. Vor allem, da ich weiß, dass sie mich darin bestärken wird, dorthin zu gehen. Wir fahren dann einfach in den Urlaub, wenn es wieder passt.
Meine Aufgabe ist es jetzt, mich nicht verrückt zu machen. Es ist nicht meine „letzte Chance“, ich habe noch eine weitere Klinik in der Hinterhand, falls es in dieser nicht funktioniert. Ich habe einen Therapeuten, der mich ambulant unterstützt und es geht mir momentan psychisch recht gut. Letzteres ist extrem gut, wie ich finde, da ich so die Möglichkeit habe, etwas von der Therapie mitzunehmen. Mich der Herausforderung besser stellen zu können, als wenn es mir schlecht ginge. Es ist eine weitere Chance. Eine weitere Möglichkeit hin zu einem Leben, in dem nicht die Erkrankungen meinen Alltag bestimmen, sondern ich mit ihnen in einer angenehmen Symbiose leben kann.
Anmerkung:
Text: Juni 2021.
Foto: Neuseeland, 2011©Kristine.
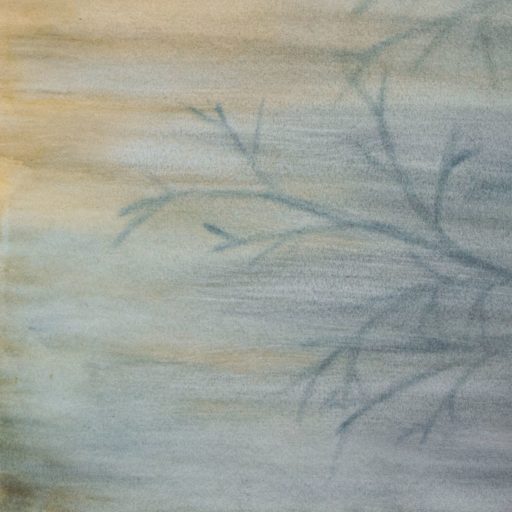


Pingback: NEBELWEGE | Wege raus aus dem Dunkel