Stocksteif stehe ich da. In meinem Kopf drehen sich die Gedanken um sich selbst, wie ein Welpe, der seinem eigenen Schwanz nach jagt. Angefeuert von lauten, unverständlichen Stimmen, alle reden durcheinander, jede:r will gehört werden, doch niemand hört dem >anderen zu. Unter meinen Füßen spüre ich, wie sich die Spitzen feiner Scherben in meine Fußsohlen graben. Löcher hinein drücken und stechen. Scherben des Scherbenhaufens, der sich unter und neben mir ausbreitet. Abertausende kleine individuelle Stücke. Glatt, spitz, scharf, matt, glänzend. Nur eines haben sie gemeinsam: Sie liegen fast vollständig im Dunkel verborge. Nur ab und an schafft es ein kleiner zarter Lichtstrahl sich den Weg durch die Dunkelheit zu bahnen – dann schließe ich geblendet reflexartig meine Augen. Zu hell, denke ich. Viel zu hell. Still stehe ich hier in Mitten des Scherbenmeeres und weiß nicht, was ich tun soll. Blicke mit leeren Augen ins Nichts, während die Gedanken sich überschlagen, als wären sie bei einer Trampolin-Wettmeisterschaft. Muss ich diesen ganzen Haufen kaputter Teile wieder zusammen setzen? Wie genau soll das funktionieren? Wo soll die Kraft herkommen? Was für einen Sinn soll das haben? Kann ich sie einfach irgendwie zusammen kleben? Kunstvoll? Kreativ? Anders, als sie ursprünglich zusammengehört haben? Oder hole ich einen Feger, sammele sie auf und werfe sie weg? Alles raus aus meinem Leben? Neuanfang? Aber wenn alles weg ist, womit soll ich dann neu anfangen? Ich möchte meine Verzweiflung, meinen Frust, meinen Schmerz herausschreien. Doch kein Ton kommt über meine Lippen. Ich möchte weinen, die Trauer aus mir herauslassen. Doch meine Augen bleiben trocken, der Kloß bleibt im Hals stecken. Ich stehe still und starre weiter leblos vor mich hin. Sehe nichts, außer Dunkelheit und Chaos. Zerstörung. Unüberwindbare Hürden.
ENTSCHEIDE DICH!
„DU MUSST DICH ENTSCHEIDEN!! SO GEHT ES NICHT WEITER!!“, hallt eine Stimme laut in meinem Kopf und ich denk: „Ja, ich weiß.“ Denn auch wenn ich hier weiter stehen kann. Bewegungslos, um mich nicht zu verletzen. Stillstehend, um es nicht schlimmer zu machen. Reglos, um kein Chaos zu verursachen. So weiß ich doch, dass ich durch bewusstes Nichtstun immer weiter in der Dunkelheit versinke. Nach unten gezogen werde vom Sog des Meeres. Dorthin, wo alles schwärzer als schwarz ist. Kein Licht mehr hinkommt. Herabgezogen in die Tiefe von der Schwere des Schmerzes. Der Schwere des Schmerzes, den ich nicht immer spüre, der aber immer da ist. In jeder einzelnen kleinen Scherbe. In ihren spitzen Kanten, den rauen Ecken, den unebenen Rändern. Solange ich hier still stehe, mich nicht bewege, mich totstelle, kann ich den Schmerz nicht spüren. Meine Füße haben sich daran gewöhnt. Sind taub. Spüren die Schnitte nicht mehr. Solange ich hier wie gelähmt stehe, bin ich sicher. Sicher, vor weiteren Verletzungen. Vor weiteren Wunden. Vor weiteren Emotionen. Zumindest in der Theorie. Denn die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Unerbittlichkeit der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die in diesem Chaos ruht, wiegt schwer. Zieht mich hinab. Das Dunkel wird noch dunkler, die Taubheit breitet sich im Körper aus und mit ihr steigt meine Verzweiflung. Und doch – für einen Augenblick fühle ich mich sicher und geborgen. Sicher, denn es kann mir nichts passieren, solange ich mich nicht rühre. Geborgen, denn ich kenne diesen Zustand so gut. Schon lange. Solange ich stillstehe, solange ich mich nicht bewege, nur weiteratme und alles ignoriere, solange ich einfach meine Augen schließe und mich totstelle, wird sich nichts ändern, wird mir nichts schlimmes passieren. Das rede ich mir zumindest ein. Jeden Tag auf’s Neue. Obwohl ich weiß, dass es ein Trugschluss ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, mich so nicht entscheiden zu müssen, stimmt das nicht, denn natürlich ist Nichtstun auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung für den Stillstand. Für das trügerische Gefühl von Sicherheit. Eine Entscheidung für die altbekannte Dunkelheit. Den Stillstand. Die Verzweiflung. Die Hoffnungslosigkeit. Die Lähmung.
Was nun?!
Nur, was soll ich tun? Meine Gedanken wirbeln in meinem Kopf umher. Mir wird übel. Schwindelig. Mein Herz rast. Wortfetzen ebenso: „Viel zu schwierig. Unkontrollierbar. Zeitaufwändig. Unbeherrschbare Emotionen. Zu viele Gefühle, wenn du dich bewegst. Egal wohin.“
Alles zu viel
In mir schreit es: „Was soll ich machen?! Ich schaffe das nie… Lass mich in Ruhe!! Geh weg!!“ „Ach, stell dich nicht so an! Andere schaffen es doch auch, du strengst dich einfach nicht genug an. Du bist selbst schuld, wenn du nicht weiter kommst. Beweg dich halt und steh nicht einfach nur so rum!“, zischt eine Stimme scharf in meinem Kopf und ZACK, bin ich keine 30 mehr, sondern ein kleines Kind.
Hallo, meine Kleine
Ein kleines Mädchen. Vielleicht acht Jahre alt? Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Die Arme um die Beine geschlungen, den Kopf auf den Knien, Tränen strömen über mein Gesicht. Ich wiege mich vor und zurück. “Warum? Warum?”, jammere ich, “Warum nimmt mich keiner in den Arm?” Ich schlage meinen Kopf gegen die Wand, will, dass der Schmerz aufhört. Schlage mit meinen kleinen Fäusten auch mich selbst ein. “Bitte sag, dass alles gut wird! Warum ist hier keiner?!?” „Du schaffst das schon. Du bist doch ein großes Mädchen. Stell dich nicht so an.“, hallt es durch meinen Kopf und ich schrumpfe noch weiter. „Ich kann das nicht. Das ist zu schwer, Mama. Hilf mir doch.“, aber keiner hört mich.
Von Erwartungen erdrückt
„Jetzt mach schon! So schwer ist es nicht!“, unterbricht eine schneidende Stimme meine Gedanken. „Du bist kein kleines Kind mehr, du bist erwachsen!“ Vielleicht, denke ich, ich fühle mich aber nicht so. Ich fühle mich hilflos. Mein Körper ist bleischwer. Mein Herz ständig am Rasen. Nebel im Gehirn verhindert die Konzentration. Schwindel ebenso. All das will mich schützen, das weiß ich. Schützen vor Leistung. Vorm Funktionieren. Vor Überlastung. Mein Gehirn ist wie in Wolken gebettet. Sicher. Weich. Undurchsichtig. Sobald ich Druck verspüre, mein Herz zu rasen beginnt, meine Hände schwitzig werden, kommt der Nebel. Lullt mich ein. Lässt mich verwirrt zurück. Lässt mich vor Hilflosigkeit erstarren.
Scherbenmeer
So stehe ich wie gelähmt da und betrachte die Scherben um mich herum. Stehe still und gucke sie nur an. Drehe mich weder in die eine, noch die andere Richtung. Entscheide mich weder für die eine, noch die andere Möglichkeit. Denn es ist leichter und sicherer einfach hier zu stehen. Kaum etwas zu spüren. Außer Überforderung. Doch das reicht. Sollen dazu wirklich noch Schmerz, Trauer, Angst und sonst was hinzukommen? Denn ich weiß, dass es kommen wird. Ganz egal für welchen Weg ich mich entscheide. Sobald ich mich bewege, muss ich fühlen. Werde ich überrollt. Überrollt, von zu starken Emotionen. Emotionen, mit denen ich nicht umgehen kann. Emotionen, die wie ein Tsunami auf mich einbrechen, unter denen ich zusammenbreche. Fühlen oder nicht fühlen. Kein Zwischending. Kein Dimmer, nur ein An- und Ausschalter: Gefühle an oder aus. Fertig. Doch angeblich soll man sie dimmen können. Habe ich gehört. Wie? Keine Ahnung. Es erscheint mir unmöglich. An oder aus. Das war es. So war es immer. So ist es normal für mich. Doch solange ich hier stehe, sind sie nicht so stark. Spüre ich sie kaum. Ich weiß, dass Stillstand keine Lösung ist. Dass mir Lähmung mehr schadet als hilft. Dass der Weg raus durch die Emotionen führt. Nur, weiß ich nicht wie. Wie ich sie fühlen soll, ohne zusammen zu brechen. Ohne den Kampf direkt zu verlieren. Ich weiß nicht, wie ich sie dimmen kann. Langsam kommen lassen kann. Nur an und aus. Da oder nicht da. Und so stehe ich hier, betrachte die Scherben um mich herum, die in der Dunkelheit kaum noch erkennbar sind. Betrachte sie und sehe gleichzeitig nichts. Fühle nichts. Lebe nicht. Denn das ist der Preis für die Ruhe.
Text: Mai 2022.
Foto: Petershof, April 2022 ©Kristine.
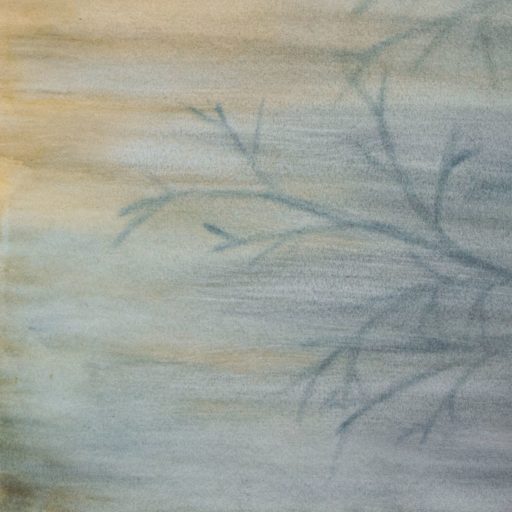


Oh mann!! Wie schwer es sein muss etwas als Erwachsene(r) zu lernen, was man hätte als Kind viel leichter und natürlicher lernen müssen! Deine Bezugspersonen haben ihre Verantwortung nicht erfüllt und haben dich nicht Kind sein lassen! Das ist wirklich sehr traurig!
Pingback: NEBELWEGE | Wege raus aus dem Dunkel