Nicht hier, nicht da, nicht fern, nicht nah, sondern irgendwo dazwischen, voll mit lauten, zynischen gemischten Gedanken, die sich um alles und nichts ranken, nur, wie erklär‘ ich’s dir? Der Körper ist taub, kaum zu spüren, meine Hände kann ich auch kaum noch fühlen und meine Beine? Sind die noch da?!
Merke, ich stehe komplett still und starr, also erst einmal laut aufstampfen, ich, klopfe mich kräftig ab, irgendwer hat gesagt, das hätte mal was gebracht, doch guess what, es ändert nichts. Ändert nichts an dem unangenehmen Gefühl, das ich in mir spür und das dem Gefühl ähnelt betrunken zu sein. Betrunken zu sein, doch sich einzureden, man sei es nicht. Manchmal ganz klardenkend, doch eigentlich schon vergiftet von all dem Zeugs in einem drin. Ähnelt dem Zustand, wenn man denkt, man habe trotz Betrunkenheit, lallen, ständigem Umfallen, alles unter Kontrolle. Wenn man nocht denkt, man sei die Person, die das Geschehen lenkt, doch eigentlich ist es der Alkohol. Es ähnelt dem Zustand, in dem man nichts will außer weiter und immer weiter zu trinken, um endlich im Nichts, in der Ruhe zu versinken.
Es ähnelt dem Gefühl nach stundenlangem Fliegen, wenn man nur noch will liegen, aber leider doch noch weiter muss. Wenn man im Flugzeug kaum konnte schlafen, ständig Hunger oder Kälte spürt, keine Lust mehr hat zu warten, es sich im Kopf dreht und der Boden schwankt.
Es ähnelt dem Gefühl, wenn man tagelang wach ist, sich aus Verzweiflung kaltes Wasser ins Gesicht spritzt, Kaffee fast intravenös zu sich nimmt und sich einredet, man sei „voll da“. Sei voll da, trotz Schwindel und Übelkeit, trotz fehlendem Gefühl zur Welt und Zeit, zur Klarheit und zur Realität. Man trinkt mehr Kaffee, hofft es hilft, doch – Überraschung – das tut es nicht. Die Hoffnung nach Klarheit, Gedanken behalten und wissen was sie ist, die Wahrheit, mehren sich. Wissen, was ist und was war. Gleichzeitig ist mir unbewusst klar, dass all die Stimulation von außen mir nicht hilft. Mir nicht hilft zu sehen und zu verstehen, was in meinem Leben geschieht, was an mir vorüberzieht und was gewesen ist.
Denn egal was ich tue, so weiß ich nicht mehr, was ich heut tat, ob ich Medikamente nahm oder sie vergaß, ob und was ich zu Mittag aß und bin daneben absolut nicht in der Lage zu rekapitulieren, wie der Tag verlief. Bekomme die Gedanken nicht zusammen, die vor mir verschwimmen, vor sich hin flimmern und oft nur in Teilen auftauchen und wild umherflitzen, in dem dunklen Raum. Es fühlt sich an wie leben ein einem Traum, surreal, verschwommen, irgendwie benommen und alles voller Schlieren. Voller Schlieren und ich, ich scheine mich irgendwo zu verlieren und frage laut nach, bin ich überhaupt wach? Ich, ich habe keine Ahnung und selbst wenn – merken könnte ich’s mir ohnehin nicht.
Nun sitze ich hier in unserer Bar, Gesicht in den Händen, halb im Schlaf und denke nach. Hocke hier, die Trauer kauert viel zu dicht neben mir und tiefsitzender Schmerz hängt auf dem Stuhl gegenüber. Drüber liegt zwar warmer Nebel, undurchsichtig und grau – oder eher dunkelblau? – ach egal, denk ich, was macht das für einen Unterschied, auf jeden Fall ist alles taub. Taub, kalt, weit weg und doch irgendwie viel zu nah. Fühl mich nicht angekommen, weder hier noch da und frage mich, was er wohl schützt, der Nebel, was er hinunter drückt, verschleiert und mit grauen Schwaden verdeckt.
Frage mich, war das schon immer da und wann kommt’s endlich komplett raus? Halte ich es solang noch aus? Wann kann ich endlich sehen, was vergraben in mir rumort, nicht schlummert, sondern sich langsam an die Oberfläche bohrt, aber eben noch nicht vollständig. Nicht so, dass ich begreifen oder fassen könnte, was mich in die Knie zwingt, was im Dunkeln unter der Erde begraben liegt, nach links und rechts hin und herrückt, nur eben nicht die Oberfläche durchstößt. Dort liegt und vor sich hin rottet, Gift langsam in mein System absondert und mich mit Wunden und Dissoziation zurücklässt. Mich leiden lässt, ohne sich zu zeigen, ohne mir die Möglichkeit zu geben, mit den Bildern zu leben und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Auseinanderzusetzen und zu integrieren, um mein Leben endlich zu leben, nicht nur vor mich hinzuvegetieren und es irgendwann zu lieben, oder zumindest zu akzeptieren. Doch anstatt zu lieben bin ich nur am Kämpfen, durch Dissoziation lassen sich Gefühle dämpfen und dank Taubheit ist nichts zu spüren. Verliere mich dabei stetig, falle ins Nichts unaufhörlich und fürchte, verrückt zu werden, langsam durchzudrehen.
Doch den „Beschützer“ in mir interessiert das kaum, er nimmt sich so viel Raum wie er gerade will, auch wenn ich dabei nur still stehe und nichts als Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit sehe. Ich flehe ihn an, doch bitte zu gehen, aber er will oder kann es nicht verstehen und harrt weiter dämpfend aus. Ich, ich frage mich, wie komme ich hier raus und wie soll es weitergehen. Weitergehen in meinem Leben, nach vorne und bewusst, nicht passiv und voll Frust und ohne nur starr daneben zu stehen. Im Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen, quälende Fragen kommen in Wellen und versperren mir die Sicht. Die Sicht in die Zukunft, die Sicht auf den Weg der herausführt aus der Dunkelheit, hinein ins Licht.
Anmerkung:
Text: März 2023. Wie sich ein dissoziativer Zustand für mich anfühlen kann.
Foto:Sommer 2023.
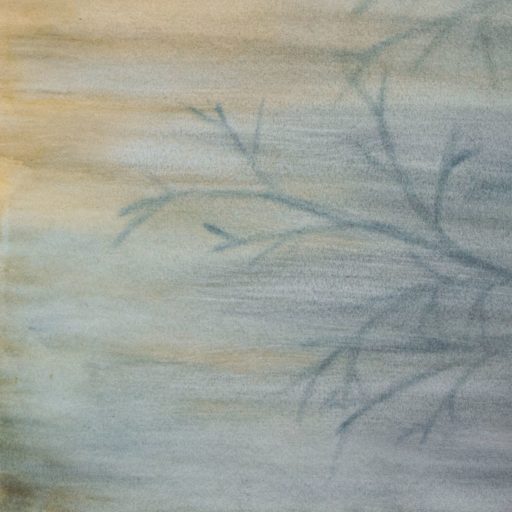


Ein toller Text! Wirklich!