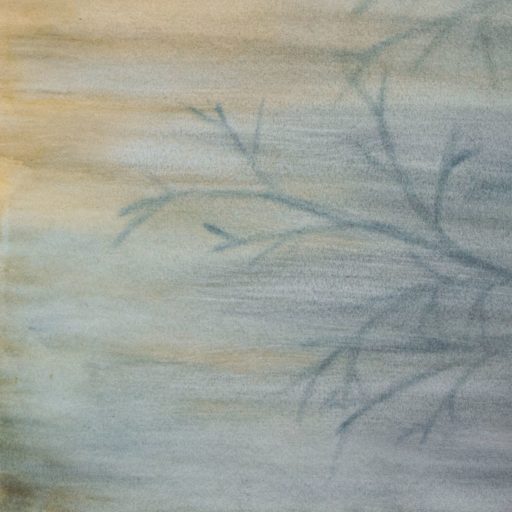Hilfe, die Klinik ist zu Ende, was nun? Wie mit der „neuen“ Situation umgehen?
Vorbereitung auf die “Zeit danach”
Bei jedem Klinikaufenthalt wurde ich sporadisch auf die „Zeit danach“, wie es immer so schön heißt, vorbereitet. Doch was genau heißt das? Und wieso ist das überhaupt wichtig?
Willkommen in der Bubble
Egal ob du in einer Tagesklinik oder einem stationären Setting untergebracht bist, du befindest dich in einer Art „Blase“. Einer Blase, in der du sicher und geborgen bist. Umgeben von Menschen, die ähnlich sind wie du. Umgeben von Hilfe, die immer dann vorhanden ist, wenn du sie brauchst. Ob in Form von der Pflege, die quasi immer ansprechbar ist, oder im Notfall Therapeut_innen und Ärzt_innen. Oder eben auch Mitpatient_innen. Irgendwer ist schon da. Dein Tag ist strukturiert, du bekommst Frühstück und Mittagessen – bei einem stationären Aufenthalt auch noch Abendbrot. Du hast feste Termine, Kurse und Aufgaben, die du erledigst. Alles ist durchgeplant. Strukturiert. Sortiert. Du bist in dieser Blase für mehrere Wochen und dann, plötzlich, bist du „draußen“. Auf dich alleine gestellt. Zurück im „wirklichen Leben“. Im Chaos. In der Unstrukturiertheit. Im „was soll ich bloß heute machen?! Aufstehen lohnt sich doch nicht – wofür denn auch?!“
Integrieren des neu Gelernten in den Alltag – leichter gesagt, als getan
Natürlich, manche kehren zu ihren Jobs zurück, aber seien wir ehrlich, ein Großteil ist aufgrund der Erkrankungen arbeitsunfähig. Und da sollst du plötzlich wieder alleine zurecht kommen? Und nicht genug damit – mit dem ganzen Kram, den du in der Klinik aufgewühlt hast? Den du angepikst hast, aber nicht fertig bearbeitet? Die ganzen neuen Infos darüber, wie du dich am besten verhalten solltest? Neue Fertigkeiten (Skills), die du natürlich schon teilweise integriert hast, aber nicht so richtig? Und außerdem ist es was anderes, ob ich in der Klinik mit einem Eispack im Nacken und einer Ammoniakampulle vor der Nase herum laufe oder eben in der Bahn. Oder ob ich in einem Kurs in der Klinik mit einem Igelball oder Stressball in der Hand sitzt, oder vor meinem Arbeitgeber oder auch Freunden. Es ist leichter unter Mitpatient_innen mal zu sagen, dass es zu viel ist und ich kurz raus gehen muss, denn ich muss mich nicht erklären. Schämst dich nicht, weil es hier in der Klinik normal ist. In Ordnung. Keine Rechtfertigungen und Erklärungen.
Wie, die Klinik ist vorbei!? So schnell?
Und dann bist du draußen. Obwohl du gefühlt gestern erst angefangen hast und das Gefühl hast, noch sehr sehr sehr viel mehr Zeit zu benötigen.
Vorstrukturierung in der Klinik
Ja klar, natürlich ist die “Zeit danach” während des Klinikaufenthaltes immer wieder Thema. Natürlich wird man darauf auch in gewisser Weise vorbereitet. Naja, ok, nicht vorbereitet, aber man soll zumindest die ersten Wochen vorab strukturieren, sich Therapeuten und Psychiatertermine sichern und sonstige Hilfeleistungen, die möglich sind. Eigene Termine wie Sport, Mittagessen etc eintragen. Ja, das ist alles sinnvoll.
Hilfreich?! Naja…
Nur… Wenn ich ehrlich bin, hilft mir das nicht. Natürlich kann ich in der Klinik selbstbewusst verkünden, dass ich selbstverständlich jeden Tag weiter um 8 Uhr aufstehen werde, frühstücke und meinen Tag strukturiert habe mit irgendwelchen Terminen und Sport und so. Aber wenn ich dann zu Hause im Bett liege, nicht zur Klinik muss und einfach NICHTS habe, was in irgendeiner Weise an diesem Tag wichtig wäre – denn ehrlich gesagt ist nie irgendwas wirklich wichtig – dann macht es wenig Sinn so früh aufzustehen. Denn das bedeutet, dass der ganze Tag vor dir liegt. Und das kann wirklich ein wenig viel sein. Natürlich. Es geht um Selbstverantwortung. Eigenverantwortung. Ich tue das für mich, für keinen anderen. Das ist richtig. Leider funktioniert es nicht immer so leicht. Was, wenn es mir scheiß egal ist? Wenn die Depression mich runter drückt und mir erzählt, dass es ohnehin alles sinnlos ist? Klar, wäre es in dem Fall noch besser aufzustehen – aber Theorie und Praxis sind einfach zwei verschiedene Sachen. Und es ist nicht so leicht, wie es klingen mag. Auch wenn du auf diese Situationen vorbereitet bist und sie kennst.
Woher kommt das ganze Chaos in meinem Kopf?!
Hinzu kommt, dass der Kopf von dem ganzen Input in der Klinik so unfassbar voll ist, dass er erst nach der Klinik die Ruhe findet, zu sortieren, Und zu denken. Viel nachzudenken.Und durchzudrehen, weil er überfordert ist. Ich habe mich oft gefühlt, als wäre ich irgendwo ins Meer geworfen worden und müsste jetzt halt selbst zusehen, wie ich durch den Sturm an Land komme. Das ging nach dem Klinikaufenthalt in der Essstörungsklinik gut, weil ich mich da auf so etwas handfestes wie Essen konzentrieren konnte und mir somit meiner Fortschritte bewusst war. Denn ich sehe ja, ob ich an dem Tag genug oder zu wenig gegessen habe. Das ist einfach. Aber wenn das nicht da ist? Wenn „nur“ die Psyche da ist, die vollkommen am Rad dreht? Dich in Stimmungen schmeißt, in denen du so nie zuvor warst. Anteile hervorholt, die seit Jahren nicht da waren. Neue Anteile zum Vorschein kommen, die sich in der Klinik manifestiert haben. Sich alles viel zu schnell zu drehen scheint und du einfach nicht mehr mitkommst. Schon beim Gedanken an das Aufstehen so überfordert bist, dass du dich lieber totstellst und hoffst, beim nächsten Aufwachen ist es Mittag. Mindestens. Am liebsten Abend und Schlafenszeit. Oder dass dein Kopf so überfordert ist, dass du einfach durch schläfst. Oder du nimmst Medikamente zur Beruhigung, damit die Panikattacken nicht so schlimm sind – dann bist du wenigstens ein wenig beduselt und bekommst nicht mehr so viel mit. Aber ganz ehrlich, kann es das sein? Nein, absolut nicht.
Wo ist die Aufklärung?!
Was also tun?
Struktur, ja, leider ist sie wichtig. Aber für mich wäre Aufklärung deutlich hilfreicher gewesen. Ich hätte gerne vorher gewusst, dass man in so ein tiefes Loch fallen kann. Auch wenn es einem in der Klinik zum Ende hin gut geht. Woher sollte ich das wissen? Beim vorherigen Klinikaufenthalt ging es mir am Ende so schlecht, das klar war, dass es zu Hause so weiter geht. Aber wenn es einem gut geht?! Da kann doch wirklich keiner ahnen, dass es danach bergab geht. Ich habe es auf jeden Fall unterschätzt
Was hätte ich anders gemacht?
Doch die wichtige Frage ist ja, was hätte ich anders gemacht, wenn ich es gewusst hätte?
Aufklärung
Zunächst hätte ich nicht so viel Angst gehabt, dass ich verrückt werde, sondern hätte gewusst, dass es passieren kann, dass mein Körper und meine Gedanken durchdrehen. Hätte verstanden, dass dieser Zustand normal ist. Keine Ausnahme. Keine Seltenheit.
Unterstützung
Ich hätte vielleicht geguckt, dass ich für die erste Woche mehr Unterstützung habe, dass ich zum Beispiel zu meiner Schwester fahre oder sie oder meinen Bruder bitte, vorbei zu kommen, sodass jemand da ist. Um zumindest die alltäglichen Dinge wie regelmäßiges Essen und Haushalt hin zu bekommen. Denn wenn es mir psychisch schlecht geht, wird auch Essen wieder zu einem Thema. Und alleine essen ist einfach schwierig. Erst recht, wenn es mir so schlecht geht, dass absolut kein Appetit vorhanden ist. Natürlich gebe ich damit auch wieder einen Teil der Verantwortung ab, auf der anderen Seite übernehme ich aber auch die Verantwortung für mich und meine Bedürfnisse, da ich mir notwendige Unterstützung suche.
Therapie
Ich wusste, dass mein Therapeut für 4 Wochen in Urlaub sein würde, wenn ich raus komme, aber ich dachte, ein wenig therapiefreie Zeit wäre sinnvoll. War es nicht. Hätte ich gewusst, wie es mir nach der Klinik gehen kann, hätte ich dafür gesorgt, dass ich mir in der Klinik irgendwo einen wöchentlichen Termin hole, sodass ich mit irgendwem reden kann. Denn das habe ich in meinem Chaos danach nicht mehr geschafft. Das hat mich vollkommen überfordert. In der Klinik hätte ich dabei aber vermutlich Unterstützung bekommen.
Kontakt mit Mitpatien_innen
Was mir total geholfen hat: Kontakthalten mit Menschen, denen es ähnlich geht wie dir. Denn dort kannst du dich einfach so melden, egal wie es dir geht. Es ist in Ordnung. Es werden keine unnötigen Fragen gestellt und alle Ratschläge, die du erhältst, sind irgendwelche Dinge aus der Klinik, die dich in dem Moment zwar total nerven, aber du weißt tief in dir drin, dass es richtig ist. Und dass du in der nächsten Situation zu ihm/ihr genau das gleiche sagen wirst. Der/die weiß, welche Skills du anwenden kannst und was eventuell hilfreich wäre. Das tut gut und ist unterstützend. Außerdem kann man sich gegenseitig motivieren, indem man Dinge gemeinsam macht oder abfragt, ob der andere dies oder das erledigt hat. Ohne, dass man sich schämt oder minderwertig fühlt. Denn das passiert mir oft bei Menschen ohne diese Erkrankungen. Wie soll sich auch jemand, der es nicht kennt, vorstellen, wie schwierig es sein kann zu Frühstücken? Oder wie unglaublich anstrengend und lange jeder einzelne Tag ist. Wie es ist, gegen Selbstverletzungs- oder auch Alkoholdruck anzukämpfen. Wie es ist, wenn du aus der Höhe in die Tiefe fällst und zurück schießt. Wie sinnlos oft alles erscheint. Aber wenn ein_e Mitstreiter_in dich fragt, ob du schon gegessen hast, dann ist es ok. Denn du weißt, dass diese Person auch mit tausend Dingen zu kämpfen hat und dich nur unterstützen möchte. Es ist einfacher, das anzunehmen. Und es ist einfacher zuzugeben, wenn du einen Rückfall hast. Denn du kannst dir sicher sein, dass du nicht verurteilt wirst. Dir wird zugehört und Verständnis ist da. Kein Gutheißen, aber Verständnis und das ist wichtig, da du dich meist ohnehin selbst schon schlecht genug fühlst.
Ehrenamt
Zudem hilft mir mein Ehrenamt. Ein flexibles Ehrenamt, wo ich ab und an mal hin kann und mithelfen kann, wenn ich möchte und dazu in der Lage bin. Eine Möglichkeit raus zu gehen und etwas sinnvolles zu tun. Ein Ergebnis zu sehen und sich dadurch besser zu fühlen. Es ist notwendig, eine Aufgabe zu haben. Eine Aufgabe, die nicht darin besteht, dass du dir selbst das Ziel setzt, morgens um 8 Uhr Sport zu machen. Auch wenn das total hilfreich und gesund sein mag – mir ist das total egal, ob ich da den Termin habe oder nicht. Es betrifft ja „nur“ mich, was soll’s. Dann doch lieber im Bett liegen und schlafen.
Perfekte Lösung? Nicht in Sicht
Ich denke, es ist unfassbar schwer sich wirklich gut auf die Zeit nach der Klinik vorzubereiten. Ich bin mir aber sicher, dass eine pauschal Vorbereitung auch nicht so hilfreich ist. Das Problem ist oft ja nicht, dass ich nicht weiß, wie ich mich am besten zu verhalten hätte. Das Problem ist vielmehr, dass mir das schlicht und einfach oft nicht möglich ist. Sei es aus psychischen oder physischen Gründen. Die Kraft, die man braucht, um einen inneren Widerstand zu durchbrechen, ist enorm. Und die kann nicht jeden Tag aufgebracht werden. Es würde helfen, zu wissen, dass auch das in Ordnung ist. Dass der Prozess bei jedem sehr unterschiedlich abläuft. Dass es auch mal in Ordnung ist, nichts bzw. nicht viel zu schaffen.
Fazit
Ich habe bislang keine perfekte Lösung gefunden. Aber, folgendes hat mir schon einmal geholfen oder würde mir helfen:
- Direkter Anschluss an ambulante Therapie
- Aufklärung in der Klinik darüber, was passieren kann
- Unterstützung für die erste Zeit nach der Klinik, um ein wenig Struktur im Alltag zu erlangen und alltägliche Dinge wie Haushalt erledigt zu bekommen
- Übungen, die man in der Klinik gelernt hat, fortführen.
- Kontakthalten mit Mitpatient_innen, da dort größtes Verständnis für verschiedene Zustände herrscht und man sich gegenseitig immer wieder an hilfreiche Ansätze erinnern kann.
- Eigene Struktur versuchen zu erstellen, am besten durch feste Termine, die eingehalten werden müssen.
Anmerkungen:
Text: Oktober 2021.
Foto: Norwegen, Herbst 2020©Kristine.